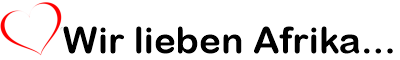Grenzerfahrungen: Von der Stille Liberias in den Hexenkessel Abidjan
Der Weg ins Ungewisse: Abschied von Liberia
Wir haben Liberia hinter uns gelassen. Rückblickend waren die Straßen dort erstaunlich gut – ein Umstand, den wir so nicht erwartet hatten. Nur wenige Abschnitte stellten für unsere "Trudi" eine echte Herausforderung dar, meist dort, wo Brücken noch im Bau waren und wir auf provisorische Umgehungen ausweichen mussten.
Der Grenzübergang selbst lag sprichwörtlich im Nirgendwo. Es war einer dieser Orte, an denen die Zeit stillzustehen scheint. Doch kaum hatten wir den Schlagbaum passiert, änderte sich das Bild schlagartig: Die Piste, die uns in der Elfenbeinküste empfing, war in einem absolut desolaten Zustand. Schlaglöcher, tief wie Krater, zwangen uns zu Schritttempo. Für die Elfenbeinküste schien dieser entlegene Grenzübergang kaum der Rede wert zu sein – oder aber die Straße erzählte noch immer die stumme Geschichte der vergangenen Konflikte.
Die Schatten der jüngsten Geschichte
Vielleicht waren diese zerstörten Wege tatsächlich noch die Nachwehen der Bürgerkriege, die das Land fast ein Jahrzehnt lang im Griff hielten. Besonders im ersten Konflikt (ab 2002) waren die Grenzen durchlässig; Söldner und Gruppierungen aus Liberia mischten kräftig mit.
Wenn man heute durch das Land fährt, muss man sich die Geschichte kurz ins Gedächtnis rufen, um das "Wunder" der Stabilität zu begreifen:
Der erste Bürgerkrieg teilte das Land in einen rebellischen Norden und einen regierungstreuen Süden. Es ging um ethnische Spannungen, um die Definition, wer ein "echter" Ivorer ist, und natürlich um den Zugriff auf Ressourcen. Kaum war etwas Ruhe eingekehrt, brach 2010 nach den Wahlen der zweite Konflikt aus, als Laurent Gbagbo seine Niederlage gegen Alassane Ouattara nicht akzeptieren wollte.
Die Bilanz ist erschütternd: Tausende Tote, Massaker wie in Duékoué und über eine Million Vertriebene. Das ist gerade einmal 14 Jahre her. Dass die Elfenbeinküste heute wieder als der wirtschaftliche Motor und Stabilitätsanker Westafrikas gilt, grenzt an ein politisches und gesellschaftliches Wunder.
Abidjan: Das "Manhattan der Tropen"
Der Kontrast könnte nicht härter sein. Nach den einsamen Pisten taucht man in Abidjan ein und glaubt, auf einem anderen Planeten gelandet zu sein. Seit 2012 wächst die Wirtschaft im Schnitt um 6 bis 7 Prozent. Als Reisender spürt man diesen Puls sofort: Abidjan blüht. Es herrscht eine Aufbruchstimmung, die fast greifbar ist.
Für uns wirkte es nach den entbehrungsreichen Wochen in den vorherigen Ländern fast wie ein Paradies. Die Menschen hier scheinen fest an ihre Zukunft zu glauben; die Hoffnung, dass die Armut nicht nur verwaltet, sondern besiegt werden kann, liegt in der Luft.
Es ist eine Stadt der Extreme:
Auf der einen Seite schießen Hochhäuser aus Glas und Stahl in atemberaubender Geschwindigkeit in den Himmel – Symbole des neuen Reichtums. Direkt daneben, im Schatten dieser Riesen, stehen kleine "Ein-Mann-Läden". Bretterbuden, in denen Getränke, Süßigkeiten oder Handykarten verkauft werden.
Auch kulinarisch zeigt sich dieser Riss durch die Gesellschaft: Wir sahen einfache, einheimische Restaurants – die berühmten "Maquis" –, wo man für wenig Geld köstlichen Fisch oder Hühnchen mit den Händen isst. Und nur ein paar Straßen weiter findet man Restaurants im französischen Stil, deren Speisekarten jedem Gourmettempel in Paris Konkurrenz machen würden. Die Preise dort sind astronomisch. Sie sind gemacht für Expats, Europäer oder jene schmale Schicht der ivorischen Oberschicht, die ein europäisches Gehalt bezieht.
Boxenstopp: Trudi, Karl Otto und die Überlebenskünstler
Unser Aufenthalt in Abidjan hatte auch einen pragmatischen Grund: Unsere Fahrzeuge brauchten Pflege. Trudi bekam vorne neue Bremsen und eine frische Batterie verordnet. Karl Otto hingegen bekam die Rundum-Erneuerung: Er wurde vorne wie hinten neu "bebremst". Dazu kam der klassische Service: Ölwechsel (immerhin 11,5 Liter!), alle Filter neu, alles durchchecken.
Die Rechnung belief sich auf rund 400 Schweizer Franken (SFr). Für uns ein fairer Preis. Doch wenn man bedenkt, dass ein Mechaniker hier oft keine 450 SFr im Monat verdient, bekommt die Summe ein ganz anderes Gewicht. Ein einziger Service kostet fast einen Monatslohn.
Das erklärt auch, warum Taxis hier so billig sind und warum so viele Fahrzeuge in einem fragwürdigen Zustand fahren: Reparaturen sind Luxus. In meinen Augen sind die Menschen hier wahre Überlebenskünstler. Das System funktioniert nur, weil man sich gegenseitig hilft. Ohne dieses Netzwerk der Solidarität wäre das Überleben in diesem teuren Pflaster kaum möglich.
Explosion einer Metropole
Abidjan ist ein Magnet. Die Hoffnung, hier das große Glück zu finden – oder zumindest als Tagelöhner nicht zu verhungern – zieht Menschen aus dem ganzen Land und den Nachbarstaaten an. Die Dimensionen sind für uns Schweizer kaum fassbar:
1950: 65.000 Einwohner (eine Kleinstadt)
1988: fast 2 Millionen
Heute: Weit über 6 Millionen Menschen
Niemand weiß genau, wohin die Reise geht. Aber für mich steht fest: Diese Bauten, die dem Himmel entgegenwachsen, verändern die Gesellschaft. Wo Beton fließt und Investoren Milliarden parken, wird Krieg unwahrscheinlicher. Wer Geld investiert, will Profit sehen und lässt sich diesen ungern von ideologischen Bürgerkriegen zerstören. Es ist ein zynischer, aber vielleicht hoffnungsvoller Gedanke: Baukräne sind besser als Panzer. Und Hochhäuser zu bauen ist allemal besser, als das Geld in Waffen zu stecken, mit denen man die eigene Bevölkerung drangsaliert, um sich an Bodenschätzen zu bereichern.
Ein kritischer Blick zurück nach Europa
Gerade diese Bodenschätze sind es, die die Region so oft ins Unglück gestürzt haben. Wir kennen das aus Liberia, und die jüngsten Nachrichten von Putschversuchen (wie in Guinea-Bissau) lassen mich nachdenklich stimmen.
Welche Kräfte stehen wirklich dahinter? Wir in Europa bekommen meist nur die gefilterte Version zu sehen – eine Version, in der Europa, seine Industrie und notfalls seine Armeen als die "Guten" oder zumindest als notwendige Ordnungshüter dastehen.
Dabei sitzen gerade bei uns in der Schweiz die Schaltzentralen jener Rohstoffriesen, die oft genug Blut an den Händen haben. Kakao, Gold, Öl – der Handel läuft über Genf oder Zug. Dieser Umstand wird in unseren Medien selten thematisiert; wir sonnen uns lieber im Image der neutralen Unschuld.
Doch wer hier mit Menschen spricht, die tief in die Strukturen blicken, erfährt anderes. Korruption ist allgegenwärtig, ja. Aber man hört auch, dass die Gelder der Korruption oft genug zurück nach Europa fließen müssen – auf Bankkonten in der Schweiz oder anderswo –, um das Wohlwollen der mächtigen Partner im Norden zu sichern. Geld ist Macht, und diese Macht wird genutzt, um noch mehr Geld abzuschöpfen.
Es liegt an uns, ob wir diese Missstände sehen wollen. Man kann hier wunderbare 14 Tage am Strand verbringen, in den Luxus-Resorts von Assinie, und die Augen vor der Realität verschließen. Niemand zwingt uns zum Hinsehen. Uns geht es gut.
Und hier zeigt sich der vielleicht größte kulturelle Unterschied: In Europa haben wir das "Teilen" oft verlernt. Wir sichern uns individuell ab. Hier in Westafrika kann das Individuum nur überleben, wenn es teilt. Wer heute hat, gibt der Sippe, damit er morgen, wenn er nichts hat, von der Sippe getragen wird.
Das ist nicht nur eine Notwendigkeit, es ist eine Philosophie. Und vielleicht ist das der wertvollste Gedanke, den wir aus Abidjan mitnehmen.